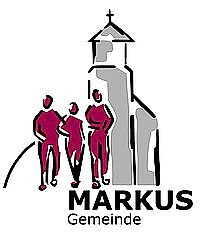Christliches ABC
Christliche Gedanken zu den Buchstaben des Alphabets.
L wie Liturgie
Wie es dieser Gemeindebrief mit seinen Hinweisen zeigt, feiern wir in der Markusgemeinde durchaus ganz unterschiedliche Gottesdienste – mit verschiedenen Schwerpunkten, Themen und Mitwirkenden, mit Taufen oder Abendmahl. Doch es gibt jeweils bestimmte Elemente, die sich in jedem Gottesdienst wiederholen – manchmal ist es sogar der gleiche Text, z. B. „Im Namen Gottes…“ oder das Vaterunser.
Dieser Ablauf oder die Ordnung eines Gottesdienstes mit seiner grundlegenden Reihenfolge bestimmter Teile macht Sinn und man nennt ihn Liturgie (altgriechisch ursprünglich: „öffentlicher Dienst des Volkes“).
Der Gottesdienst selbst wird als eine Begegnung zwischen Gott und Mensch verstanden. Gott dient und beschenkt uns mit seinen Worten und seiner Liebe und wir wenden uns Gott zu.
So gibt es beispielsweise wie bei einem Treffen mit Menschen eine Begrüßung und einen Abschlussteil.
Die Liturgie umfasst jeweils drei Teile, wenn das Abendmahl gefeiert wird, kommt ein weiterer dazu:
Eingangsteil mit „Im Namen“, Psalm und Eingangsgebet
Lesungen, Glaubensbekenntnis, Predigt
(Abendmahl)
Fürbittengebet, Vaterunser und Segen
M wie Musik
Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir uns während unserer Ausbildung zum Gemeindepfarrer/ in darüber mit Kirchenvertretern gestritten haben, ob moderne Musik im Gottesdienst überhaupt sein darf. Es gab hitzige Diskussionen über dieses Thema. Heute ist dieser Streit längst ad acta gelegt. Es hat sich vielmehr die Meinung durchgesetzt, dass es eigentlich keine „christliche“ und „unchristliche“, sondern nur gute und schlechte Musik gibt. Auch die Frage, ob in einem Gottesdienst nur die Orgel zu spielen habe, stellt heute niemand mehr. Musik ist doch Musik – ganz gleich, welches Instrument daran beteiligt ist. Musik will das Herz erreichen! Sie verkündigt das Evangelium eben auf eine andere Art als eine Predigt. Deshalb ist jede Musik im Gottesdienst willkommen, wenn sie dem Lobe Gottes dient und Menschen Frieden bringt.
N wie Nächstenliebe
Ist das nicht ein schwieriger Begriff? Soll ich wirklich stets meinen Nächsten lieben, also die Menschen, die mir gerade besonders nahe sind also Arbeitskollegen, Menschen in der Straßenbahn, die Dame vor mir in der Gemüseabteilung?
Als Erklärung dafür, wer denn mein Nächster ist, hat Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, das davon handelt, wie ein Mensch beraubt wird und verletzt am Wegesrand liegt und auf Hilfe wartet. Jesus sagte, solche Menschen sind unsere Nächsten.
Also doch mein Arbeitskollege neben mir? Es geht als um eine Haltung! Nämlich um die, in allen Menschen um mich herum Jesus zu erkennen, den Bruder und die Schwester, die von Gott genauso geliebt wird, wie ich. So wie ich behandelt werden möchte, soll ich es auch den anderen tun. Das ist das Leben im Sinne Jesu.
O wie Orgel
Die Orgel ist das größte aller Musikinstrumente und spielt baulich in Kirchen sowie natürlich auch in der klassischen Kirchenmusik eine große Rolle. Sie wurde von Wolfgang Amadeus Mozart auch als „die Königin der Instrumente“ bezeichnet. Das liegt nicht nur daran, dass sie wegen ihrer Größe so imposant ist, sondern sie stellt auch durch ihre große Klangbreite fast ein kleines Orchester dar. Die Orgel besteht nämlich aus vielen unterschiedlich großen und dicken Pfeifen aus Holz und Metall, die jeweils einen unterschiedlichen Klang hervorbringen. Durch diese Orgelpfeifen strömt die Luft – und zwar jeweils durch diejenigen, die als Register gezogen werden.
Eine Orgel hat mindestens zwei Klaviaturen, die mit den Händen zu betätigen sind, die man Manuale nennt. Außerdem gibt es eine Klaviatur für die Füße, das Pedal.
Orgeln gab es schon in vorchristlicher Zeit, wobei sich die Orgelbaukunst immer stärker entwickelt und ausdifferenziert hat. Sie war immer schon eine Wissenschaft für sich. Da im Mittelalter die Entwicklung und Weitergabe von Wissen und Kultur oft in den Händen von Mönchen lag, etablierte sich damit die Orgel, ursprünglich ein weltliches Instrument, in den Kirchen. Anfang des 14. Jahrhunderts galt die Orgel in Europa als Kircheninstrument. Die Barockzeit gilt als die Blütezeit von Orgelspiel und Orgelbau.
Bis heute werden Orgeln gebaut. Sie sind immer individuell und klingen niemals gleich, weil auch die Akustik in dem Gebäude eine große Rolle spielt. Weil der Umfang eines Orgelbaus und seine Kosten durchaus beträchtlich sind, vergleicht man ihn mit einem Hausbau.
P wie Presbyterium
Der Begriff Presbyterium stammt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „Rat der Ältesten“. Diese Bezeichnung kommt daher, dass man dem Alter besonders viel Weisheit zugeschrieben hat. Weisheit und Erfahrung sind sicher notwendig, um eine Gemeinde zu leiten, denn in Westfalen und einigen anderen Landeskirchen nennt man das Leitungsgremium einer Kirchengemeinde Presbyterium.
Altersmäßig gibt es auch Vorgaben. Am Tag ihres Amtsantritts müssen die Presbyterinnen und Presbyter mindestens 18 und höchstens 74 Jahre alt sein. Seit neustem gibt es zusätzlich eine Person, die speziell für die Arbeit mit jungen Menschen steht und die selbst zwischen 18 und 27 Jahren alt sein muss; in dieser Funktion wird man vom Presbyterium berufen, hat aber die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Presbyteriumsmitglieder. Wer in diesem Gremium mitarbeitet, muss darüber hinaus Gemeindeglied sein.
Das Presbyterium entscheidet über die unterschiedlichsten Belange der Gemeinde – über die Arbeitsschwerpunkte, die Mitarbeitenden, die Gebäude, die Finanzen, vertritt die Gemeinde nach außen und ist maßgeblich für das Profil verantwortlich. Wenn die hauptamtlichen theologischen Mitarbeiter und Mitarbeiter demnächst für mehr als eine Gemeinde zuständig sind, wird die Bedeutung des Presbyteriums noch weiter wachsen.
Neben der erwähnten Weisheit ist es hilfreich, wenn in diesem Gremium unterschiedliche Fähigkeiten zusammenkommen - wie berufliche Qualifikationen, persönliche Interessen, aber vor allem auch Teamfähigkeit und die Freude daran, mit anderen Gemeinde zu gestalten.
Die Anzahl der Presbyterstellen ist grundsätzlich abhängig von der Größe der Gemeinde. Das Presbyterium wird jeweils für vier Jahre gewählt.
Q wie Quasimodogeniti
Quasimodo kennen manche aus der Literatur. Die Titelfigur von Victor Hugos Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ trägt diesen Namen. Er wird als auffällig hässlich geschildert, hat z. B. einen Buckel und sein eines Auge ist mit einer Warze bedeckt. Zu seiner Lebensaufgabe wird das Läuten der Glocken der Kirche Notre Dame de Paris. Der Klang dieser Glocken ist seine große Leidenschaft, aber auf der anderen Seite wird er durch das jahrelange Glockengeläut auch taub. Seinen Namen hat er von seinem Adoptivvater Frollo bekommen – und hier kommt jetzt das christliche ABC ins Spiel -, weil er ihn im Alter von ca. vier Jahren am Sonntag Quasimodogeniti auf den Treppen von Notre Dame gefunden hat.
Quasimodogeniti ist also der Name eines Sonntags - des ersten Sonntags nach Ostern. Viele Sonntage im Kirchenjahr tragen lateinische Bezeichnungen und Quasimodogeniti ist der lateinische Beginn eines der Texte, die an dem Tag gelesen werden – „wie die neugeborenen (Kinder)“, heißt es da. Der Text erinnert an den durch Ostern gesetzten Beginn eines neuen Lebens in Jesus Christus. Die Gläubigen, gerade auch die an Ostern Neugetauften, sollen sich „wie neugeborene Kinder“ fühlen, nachdem durch die Auferstehung Jesu der Tod besiegt ist.
R wie Radtouren
Vielleicht wundert sich jetzt der eine oder die andere über die Zuordnung von Radtouren zum christlichen ABC, aber es ergibt durchaus Sinn.
Zum einen gehören Radtouren zu unserem jährlichen Gemeindekalender – an einem Samstag mit den jeweiligen Konfis. Am Sonntag danach geht es dann noch einmal mit den Eltern der Jugendlichen los. Außerdem gibt es in diesem Herbst – genauso wie im letzten Jahr – einen gemeinsamen Termin mit einer Radtour durch Gemeinden in der Nachbarschaft.
Christsein ist immer auch Unterwegssein und Weggemeinschaft und da entwickelt sich manchmal eben auch das eine oder andere Gespräch über Gott und die Welt.
Ebenfalls können Kirchen Ziel oder Rastpunkt auf Radtouren sein. In Deutschland und der Schweiz gibt es immer mehr Radwegekirchen, die sich in der Nähe von Radwanderwegen befinden und die besonders auf die spirituellen und auch praktischen Bedürfnisse von Radfahrenden eingerichtet sind (www.radwegekirchen.de).
Nicht zuletzt ist das Fahrrad eine sehr nachhaltige Form der Mobilität und damit ermöglicht es einerseits unterwegs zu sein und Gottes Schöpfung in ihrer Fülle und Weite wahrzunehmen und sich an ihr zu freuen und sie gleichzeitig zu schonen und zu bewahren.